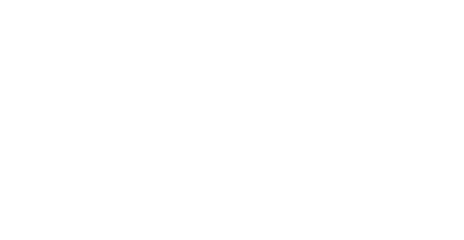TIerhaltung
Tierwohl ist mehr als nur eine frage der Haltung.
Füchse sind zwar keine Rudeltiere, Schweine hingegen schon. Und Stallkonzepte, die auf Kastenständen basieren, sind veraltet – da sind wir sicher einer Meinung. Deshalb bevorzugen wir offene, zusammenhängende Buchten mit über 100 m², um Schweine in Gruppen zu halten. Die Haltung definiert somit die äußeren Umstände der Unterbringung auf dem Bauernhof. Dabei werden nicht nur das Platzangebot, sondern auch die Auslauffläche, offene Fronten, die klimatischen Bedingungen und die Beschäftigungsmöglichkeiten berücksichtigt, um ein natürliches Verhalten der Schweine zu fördern.
Unter Tierhaltung definieren wir

Beschäftigung

Außenklima

Platzangebot

Zertifizierung
1.1 – Beschäftigung der Tiere
Das Ausleben artgerechten Verhaltens zählt zu den wichtigsten Zielen der tierwohlorientierten Haltung. Dabei ist das Nachahmen natürlicher Verhaltensweisen der Tiere in der Nutztierhaltung von entscheidender Bedeutung. Im Fall von Schweinen beinhaltet dies den Wühltrieb im Waldbereich, bei Hühnern das Picken in der Waldrand-Zone und bei Rindern das Wiederkäuen auf der Weide. Im Hinblick auf das Wühlverhalten hat sich die Strohhaltung als die tierwohlgerechteste Form der Schweinehaltung etabliert. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass Stroh in Raufen lediglich das „Kauen“ als Beschäftigung ermöglicht, während erst eine ausreichende Menge an Stroheinstreu das Wühlen der Tiere ermöglicht. Die Möglichkeit von Stroheinstreu zum Wühlen und Wärmen ist übrigens erst ab Stufe 4 in der Haltungsform, in der staatlichen Haltungskennzeichnung erst in der höchsten Stufe berücksichtigt.
1.2 – Außenklima in der Haltung
Das Außenklima bzw. „frische Luft“ ist vor allem aus Sicht einer naturnahen Haltung ein gewichtiges Argument, das sich viele Verbraucher für die Tierhaltung wünschen. Aus tierwohlorientierter Sicht ist „naturnah“ jedoch nicht nur als Vorteil zu bewerten, sondern muss daher differenziert betrachtet werden. Winterliche Temperaturen oder Futtermangel stellen in der Natur eher eine Herausforderung dar, die es zu überleben gilt und oft ein Schutzbedürfnis bei Tieren hervorruft. Dies kann durch den Menschen in Form von Stallungen und ähnlichem gewährleistet werden. Tiere in menschlicher Obhut sollten es besser haben als in der Natur.
Ganz konkret hinterfragen wir die gängige Praxis der Richtlinien vieler Haltungslabels, die die Freilandhaltung bei Schweinen, Rindern und Hühnern gleichwertig empfehlen. Dies ist wissenschaftlich nicht gerechtfertigt. Bei der tierwohlorientierten Haltung von Rindern ist die Freilandhaltung die beste Form, da Rinder tatsächlich Wiesenbewohner sind, die sich lieber auf einer Weide als im Wald aufhalten. Als Wiederkäuer mit Hörnern ist das auch logisch, im Wald finden sie kein Gras und die Hörner sind nachteilig. Hühner als Waldrandbewohner nutzen beides, Wiese und Wald, beziehungsweise den Stall als Ersatz für den Wald. Aber Hühner halten sich immer nahe am Wald oder respektive am Stall auf, daher ist meistens in einem Radius von 1-3 Metern um den Stall kein Gras mehr vorhanden. Die Tiere trauen sich selten weiter.
Bei Schweinen ist dies anders, da sie Waldbewohner sind und sich normalerweise nur widerwillig auf Freiflächen aufhalten. Haben Sie schon einmal ein Wildschwein auf einer Wiese gesehen? Nein, aber warum halten wir dann Hausschweine dort? Aktuell scheint die Tierwohlwerbung zwar einig zu sein, dass ein nicht überdachter Auslauf für über 50% der Stallfläche wichtig ist. Aber ob dieser tatsächlich das Wohlergehen der Tiere fördert oder lediglich die Werbung über alle Tierarten hinweg erleichtert, ist fraglich. Eindeutig ist, dass das Außenklima einer von vielen Vorteilen für eine tierwohlorientierte Haltung von Schweinen ist, jedoch allein nicht ausreicht. Die Art des Beschäftigungsmaterials wie z.B. Stroh und die Struktur der Buchten sind für eine optimale Schweinehaltung weitaus wichtiger als eine Wiese. Bei Rindern ist dies genau umgekehrt.
Ein weiteres Argument ist, dass die Freilandhaltung von Schweinen kaum von Landwirten genehmigt wird. Selbst das Land Nordrhein-Westfalen konnte keine Baugenehmigung für einen eigenen Tierwohlstall im Landesinstitut Haus Düsse erhalten. Dies mag paradox klingen, aber gängige Siegel reduzieren Tierwohl nicht nur auf wenige Mindestkriterien, sie wählen mit der Freilandhaltung von Schweinen sogar eines der am schwersten umsetzbaren Kriterien aus, für das es zudem noch die wenigsten wissenschaftlichen Belege gibt.
Schweine sind Waldbewohner, und dieses Umfeld muss nachgeahmt werden. Ein Stall kann dies oft besser schaffen als eine wiesenartige Fläche ohne Bäume. Am besten wäre jedoch eine Haltung im Wald. Mehr dazu unter 1.2.3. Auslauf.
1.3 – Zusätzlicher Bewegungsfreiraum
Innerhalb der öffentlichen Wahrnehmung wird „mehr Platz“ grundsätzlich gleichgesetzt mit Tierwohl. Dabei ist es für Verbraucher und Laien generell schwer einzuschätzen, welche Größen realistisch und im Sinne des Tierwohls sind. Während schlüssige Beweise existieren, die zeigen, dass der gesetzlich vorgeschriebene Platz für ein Tier kaum ausreicht, ist „100% mehr Platz“, wie es fast alle Haltungslabels fordern, nicht ausreichend komplex. Ein einzelnes Tier hat bei 100 % mehr Platz weniger Bewegungsfreiheit als eine Gruppe von 50 Schweinen mit dem gesetzlichen Platzangebot! Neben dem Platz pro Tier ist die Gruppen- und Stallgröße mindestens genauso wichtig. Deshalb verzichten die Tierwohlpunkte bewusst auf eine populistische Werbung mit „% mehr Platz pro Tier“ und kontrollieren stattdessen, ob die Tiere wirklich ihren Bewegungsdrang ausleben können.
Es gibt einschlägige Beobachtungen, die zeigen, dass das Platzangebot mit zunehmender Gruppen- und Stallgröße automatisch steigt, da Schweine Herdentiere sind und somit teilweise nahe beieinander liegen und sich in der Gruppe bewegen. Wir beobachten, dass eine Großgruppe von z.B. 100 Schweinen bei 40% mehr Platz mehr Bewegungsfreiheit hat als eine kleine Gruppe von 15 Schweinen bei 100% mehr Platz! Deshalb berücksichtigen die Tierwohlpunkte Platz, Gruppengröße und Alter der Tiere.
Die Frage, wie viel Platz pro Tier im Sinne des Tierwohls angemessen ist und ab wann dieser gesättigt ist und keinen weiteren Nutzen für die Tiere bringt, sollte jedoch den Experten überlassen bleiben. Zusätzlich stellt sich die Frage, welche anderen Faktoren, sofern die Anforderungen im Bereich Platz erfüllt sind, das Wohlbefinden der Tiere darüber hinaus steigern könnten. Daher möchten wir, sofern Gruppengröße und Platzangebot im Gleichgewicht sind, eher dazu motivieren, nicht noch mehr Platz zu schaffen, um Übersättigung zu vermeiden, sondern sich vielmehr auf eine Steigerung des Tierwohls in Bezug auf weitere Aspekte wie Transportwege und -abläufe oder Tiergesundheit zu konzentrieren.
1.4 – Zusätzliche Zertifizierungen