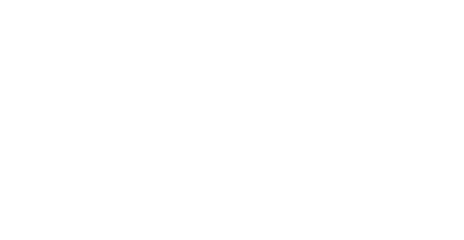Tierschutz
Unerlässlich: Tierschutz in der Mastschweinhaltung
Durch zertifizierte Tierwohl-Schlachthöfe verhindern wir den Einsatz von Leiharbeitern, Akkordarbeit und regelmäßig auftretende Skandale in den Nachrichten. Unser Ziel ist es, mit höheren Margen ein geringeres Schlachtvolumen zu erreichen. Wir fördern sensibilisierte und regelmäßig geschulte Mitarbeiter, begrenzte Transportzeiten, lange Ruhezeiten und klar definierte Betäubungsmethoden.
Zum Tierschutz zählen außerdem die Haltungsbedingungen von Ferkeln und Sauen. Die Trennung von der allgemeinen Haltung hat den Vorteil, dass wir eine Vergleichbarkeit der Siegel sicherstellen können, aber dennoch nicht auf das Tierwohl von Ferkeln und Sauen verzichten müssen. Denn Haltungskriterien anderer Siegel sind in der Regel auf Mastschweine ab 30 kg beschränkt.
Mit Tierschutz meinen wir

Zugang
zu Futter

Zugang
zu Wasser

Struktur
der Buchten

Ferkel- & Sauenhaltung

Sachkunde &
Kontrolle

Einsatz
robuster Rassen

Kurze
Transportwege

Kontrollierte
Schlachtung
2.1 – Raufutterzugang
Über das Futter lässt sich das Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere am besten steuern. Dabei spielt grobes Futter (wie Ballaststoffe beim Menschen) eine besondere Rolle, da es maßgeblich zu einer gesunden Darmflora und somit zu einem stabilen Immunsystem beiträgt. Allerdings führt es nicht zu einem schnellen wirtschaftlichen Wachstum und wird daher oft eingeschränkt oder weggelassen, wenn keine angemessenen Preise gezahlt werden. Es sollte mindestens ein Zugang zu grobem Futter gewährleistet sein, noch besser ist jedoch ein Mindestanteil von etwa 4 % grobem Futter in der Endmast.
2.2 – Tränken
Der Zugang zu Wasser ist essentiell und wird oft vernachlässigt. Dabei ist nicht nur die Anzahl von Tränkeplätzen, sondern auch die Form und Funktion wichtig.
Die sogenannten Tränke-Nippel kommen häufig zum Einsatz aufgrund ihrer Effizienz und der Reduktion des Wasserverbrauchs. Ein Nachteil ist jedoch, dass diese Art der Wasserversorgung vor allem von Jungtieren oft erst sehr spät erkannt und begriffen wird, was wiederum zu Dehydrierung der Tiere führen kann. Auch das „Schwanzbeißen“ unter den Tieren kann mittlerweile unter anderem hierauf zurückgeführt werden. Um das Tierwohl zu steigern, sollten alternative sowie traditionelle Tränke- und Futterplätze zur Verfügung stehen.
2.3 – Buchtenstrukturierung
In der öffentlichen Diskussion wird dies meist auf Spaltenböden reduziert, aber auch dieser Aspekt ist weit aus komplexer und die öffentliche Diskussion wird selten dem Tierwohl gerecht. Es hat erhebliche Nachteile die Tiere ausschließlich auf Spaltenboden zu halten, es hat aber auch Vorteile kleinere Flächen derart zu gestalten. So wichtig Stroh ist, so sollte das Schwein zwischen Stroh und „kalten“ Böden wie Betonspaltenböden wählen können. Als Liegekühler kann das Schwein dadurch seine Temperatur regulieren und wie ein Haushund liegt es gerne auch mal auf Fliese obwohl ein teurer Hundekorb zur Verfügung steht.
2.4 – Sauenhaltung und Ferkelaufzucht
Da klassische Haltungslabels wie die Haltungsform oder die staatliche Haltungskennzeichnung die Sauen- und Ferkelhaltung nicht kontrollieren, zählen wir diese unter Tierschutz. Dies verdeutlicht auch, warum Bio ein Tierschutzlabel ist; hier gelten die strengsten Kriterien.
Während die meisten Tierschutzlabels jedoch Ferkel und Sauen pauschal betrachten und die Ressourcen gleichmäßig auf beide Gruppen verteilen, empfehlen wir, die Sauen zu priorisieren und mehr Wahlrecht zu schaffen! Sobald die Ferkel alt genug sind, fallen diese automatisch unter den Schutz der Haltungslabels, aber die Sauen nicht. Das heißt, die Sauen erfahren aktuell tendenziell weniger Haltungsschutz. Gleichzeitig sind die Herausforderungen bei der Geburtenbegleitung derart anspruchsvoll, dass der Landwirt mehr Spielraum braucht, um Sauen und auch ihre Ferkel optimal zu schützen.
2.5 – Kontrolle und Sachkunde
Für viele Labels ist Kontrolle die universelle Lösung, weil Erfolge nicht messbar sind. Für die Tierwohlpunkte hingegen ist es nur ein Mittel zum Zweck, da wir durch die Messung der Tiergesundheit die Qualität und Betreuung des Landwirts besser beurteilen können. Während viele große Industriebetriebe mit Audits und Nachweisen glänzen können, zeigt die Tiergesundheit oft weniger Erfolg. In den letzten Jahren nehmen die Forderungen nach Nachweisen immer mehr zu, die Messung von Erfolgsergebnissen wird jedoch nicht verfolgt. Das ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil für Großbetriebe und benachteiligt kleinere Erzeuger.
Die Tierwohlpunkte haben aus diesem Grund den Tiergesundheitsbenchmark entwickelt.
2.6 – Robuste Rassen
Eine Haltung von haarlosen Industrierassen wie dem Pietrain in Auslaufställen ohne Stroh, wie es die staatliche Haltungskennzeichnung erlaubt, kann nicht empfohlen werden. Viele robuste Rassen wie das Duroc oder das schwäbisch-hällische Landschwein sind heute gut erforscht und eignen sich hervorragend. Leider finden diese fast ausschließlich in Fleischprogrammen von Handwerksmetzgereien Beachtung, weshalb sie auch aus Tierwohlsicht besonders betrachtet werden sollten. Im Bio-Bereich gibt es zwar ausreichend Stroheinstreu im Gegensatz zur staatlichen Haltungskennzeichnung, der Einsatz von robusten Rassen ist jedoch merklich geringer als im Fleischerhandwerk.
2.7 – Transport
Das Thema Tiertransport ist emotional sehr aufgeladen, einerseits durch skandalträchtige Berichterstattungen, aber auch weil viele Tiere Transportzeiten von bis zu 24 Stunden erleben. Dies ist nicht im Sinne des Tierwohls, und es gilt ganz klar, die Wege kurz zu halten, um die Zeiten so gering wie möglich zu gestalten.
Der Bio-Standard lässt zumeist Wege von bis zu 4 Stunden Fahrtzeit zu, in der Haltungsform 4 sind bis zu 24 Stunden erlaubt. Beide Systeme, auch Bio, erlauben jedoch eine Lieferung zu den größten Schlachthöfen Europas! An dieser Stelle können viele Direktvermarkter wie beispielsweise Handwerksmetzgereien punkten. Diese bieten zwar selten Bio-Produkte an, aber oft eine gute oder sogar bessere Alternative, da sie häufig selbst schlachten.
2.8 – Schlachtung
Wir bitten um Dein Verständnis, dieser Text befindet sich noch in Arbeit.